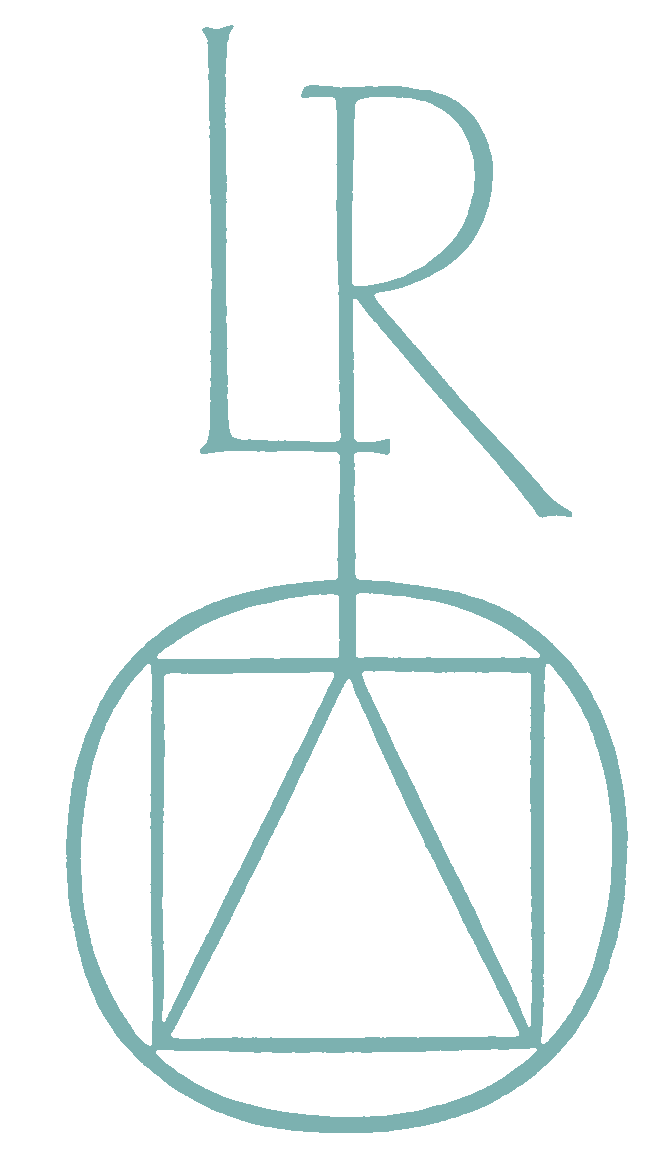Dieses Buch gibt einen ausgewählten Überblick über die Forschungslandschaft der Künstlerischen Therapien (Kunsttherapie, Musiktherapie, Tanztherapie). Es wendet sich in erster Linie an tätige Künstlerische Therapeuten und Therapeutinnen sowie die Studierenden der verschiedenen Fachgebiete, die sich über die Vielfalt möglicher Forschungsansätze orientieren möchten, Argumente für die Diskussion bezüglich ihres therapeutischen Vorgehens und deren wissenschaftlicher Begründung suchen, oder selbst ein Forschungsvorhaben ins Auge fassen.
Mit Beiträgen von:
Marianne Eberhard-Kaechele - Ulrich Elbing - Harald Gruber - Wolfram Henn - Eva Herborn - Jana Marie Kalle-Krapf - Petra Keller - Helmut Kiene - Jürgen Kriz - Sylvia Kunkel - Rudolf zur Lippe - Susanne Lücke - Regine Merz - Peter Petersen - Bernd Reichert - Lony Schiltz - Gertraud Schottenloher - Constanze Schulze - Heike Signerski - Peter Sinapius - Rosemarie Tüpker -Elisabeth Wellendorf - Eckhard Weymann - Thomas Wosch
„Das Buch ist äußerst breit gefächert und zeigt ein sehr vielfältiges Spektrum künstlerischer Therapieformen und entsprechender Forschungsansätze. Es enthält mehrere anschauliche Falldarstellungen, aber auch Beschreibungen von statistischen Verfahren aus der Musik- und der Kunsttherapie, will aber bewusst kein Kompendium für Forschungsmethoden sein. Viele der Autoren setzen sich intensiv mit der teilweise sehr unterschiedlichen Herangehensweise künstlerisch-therapeutischer Forschung im Vergleich zur medizinisch-naturwissenschaftlich geprägten Forschung auseinander. Gleichwohl sind die Anforderungen forschend-wissenschaftlicher Arbeit auch in den künstlerischen Therapieformen nicht infrage gestellt, werden hingegen aber anders, besonders in der Methodik und den Zielsetzungen, akzentuiert. Es sei eben gerade nicht zielführend, die klassischen Forschungsmethoden der Medizin oder Psychotherapie unbesehen auf die Künstlerischen Therapien zu übertragen. Neben dem Forschen als Motor der Innovation hat Forschung auch den Zweck der Reflexion auf die eigene Tätigkeit und die entsprechende Kommunikation dieser Reflexion. Besonders letzteres ist bislang bei den künstlerisch-therapeutisch Tätigen und Forschenden vergleichsweise gering ausgeprägt. Gerade daher ist dieser vielseitige Sammelband für an Forschungsmethoden Künstlerischer Therapien Interessierte aus unterschiedlichen Bereichen, wie für die Forschenden und den Nachwuchs der einzelnen „Zünfte“ selbst, weiterhin sehr wertvoll.“
Anette Hoffmeier
In: Musik und Gesundsein. Heft 22 (2012). S. 44-45.
--------------------------------------
„Wer ein deutschsprachiges Buch zur Hand nehmen möchte, dem sei der Band „Forschungsmethoden Künstlerischer Therapien“ angeraten, der von Peter Petersen, Harald Gruber und Rosemarie Tüpker herausgegeben wurde. Die Kunsttherapien rüsten gleichsam methodisch auf, sie haben gewiss etwas zu bieten, das nachzuweisen sie sich immer mehr genötigt sehen, und sie tun’s. Beiträge gehen deshalb um Wirksamkeitsbeurteilung (Helmut Kiene), suchen angemessene Formen wissenschaftlichen Vorgehens (Rosemarie Tüpker) und das aus Frustration aus dem Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie (WBP) zurückgetretene Mitglied Jürgen Kriz zeigt in einem bemerkenswerten Text, welche verheerenden
Folgen die Einseitigkeit des Wissenschaftskonzepts des WBP für ein breit angelegtes Verständnis von therapeutischen Prozessen und Vorgehensweisen hat. Sein Beitrag bietet gewissermaßen den anderen Beiträgen wissenschaftlichen Flankenschutz. Dann aber können sich reiche Dimensionen auftun, wir sehen wieder die Einführung einer anthropologischen Ästhetik (Rudolf zur Lippe) oder lesen über das „Ästhetische Antworten“. Es gibt eine systematische Bildanalyse in der Kunsttherapie (HaraId Gruber), ja sogar bereits eine Datenbank und eine kunsttherapeutische Forschung mit Sterbenden - gerade daran wird mir deutlich, was einer Therapieform, die ausschließlich auf das Vernunftmoment der Einsicht setzen würde, fehlen müsste. Einzelne Arbeiten stellen Forschungsbefunde musik- und kunsttherapeutischer Behandlungen einzelner Krankheitsbilder zusammen, etwa zu somatoformen Störungen, zur Traumabehandlung oder bei AIDS-Erkrankten. Es gibt Videoaufzeichnungen musiktherapeutischer Improvisationen und Techniken zu deren Mikroanalyse, die Thomas Wosch beschreibt. Heike Signierski, die ebenfalls an unserem schon genannten Hildesheimer Graduiertenkolleg teilgenommen hatte, berichtet aus ihrer jetzt abgeschlossen Dissertation. In dieser Dissertation hat sie eindrucksvoll zeigen können, dass es Isomorphien gibt zwischen einer musiktherapeutisch angeregten Improvisation von Therapeutin und Patient, einer nachfolgenden stillen Niederschrift des bei der Improvisation Erlebten durch beide Beteiligte und der Aufzeichnung + Transkription des daran anschließenden therapeutischen Gesprächs. Die Arten des Zuspielens von Themen, das Aufgreifen und deren Variation, die rhythmische Gestaltung und Synchronisation konnten sich in allen drei „Daten-Bereichen“ (Improvisation, Geschichte aufschreiben, Gespräch) finden lassen. Sie hat das an der musiktherapeutischen Behandlung von immerhin 10 Borderline-Patienten gezeigt, eine schöne qualitative Studie.
Liest man diese Beiträge, muss man Jürgen Kriz Recht geben. Sie alle zeigen, welche Einseitigkeit (so Kriz), welche Beschränkung (würde ich lieber sagen) eine empirische Psychotherapieforschung darstellen würde, die sich als allein seligmachende Forschungskultur durchsetzen könnte. Wo durch solche Definition alle anderen kulturellen Forschungswelten machtvoll in den Status der Subkultur verbannt würden, wäre nicht nur die Menschlichkeit, das Musikalische des therapeutischen Gesprächs, das Märchenhafte der gewählten Analogien bedroht. Solche Deflnitionsmacht wäre vielmehr
für eine Therapeutik, die sich dieser Menschlichkeit in vollem Umfang anzunehmen hätte, eine Gefahr, weil sie sich die eigene Grundlage entzöge. Nur ausschließlich technizistisch verstandene Therapeutik würde sich des Besten berauben, was Therapeutik wirken kann. Der Band zeigt eindrucksvoll, wie Musiktherapeuten wissenschaftlich eine Art Nachrüstung beginnen; sie wollen - und sollen - ernstgenommen werden, weil sie etwas am Therapeutischen bewahren, das den anderen, auf „Intervention“ und Beseitigung einer „Störung“ so einseitig setzenden Therapeutiken verloren geht. Über das technizistische Moment hinaus, das uns seitens allzu vieler Evaluationsstrategen und Qualitätssicherern aufgenötigt wird, kommt es darauf an, die ästhetischen Dimensionen des Menschlichen zu bewahren. In ihnen liegt heilsame Kraft.“
Michael B. Buchholz
In: Psycho-News-Letter (PNL). Nr. 88 (2011). S. 17.
 Inhalt
29,0 KB
Inhalt
29,0 KB
 Leseprobe 2
110,1 KB
Leseprobe 2
110,1 KB
 Leseprobe 3
304,6 KB
Leseprobe 3
304,6 KB
 Leseprobe 5
121,8 KB
Leseprobe 5
121,8 KB
 Leseprobe
100,7 KB
Leseprobe
100,7 KB
 Vorwort
58,2 KB
Vorwort
58,2 KB
 Leseprobe 4
174,9 KB
Leseprobe 4
174,9 KB
 E-book
26,4 MB
E-book
26,4 MB