Wappen bilden zentrale Bestandteile der mittelalterlichen Lebenswelt. Dennoch wurden heraldische Zeichen aus historisch-grundwissenschaftlicher Perspektive bis zuletzt vornehmlich auf identifikatorische und repräsentative Funktionen reduziert, aus literaturwissenschaftlicher Sicht hingegen als Mikromotive und deskriptives Ornament marginalisiert. Gegen beide Tendenzen zeigt die Studie grundlegend das ästhetische und poetische Bedeutungspotential ‚wortgewandter‘ Wappen in der europäischen Literatur des Hochmittelalters auf. Sie versteht sich als interdisziplinärer Dialog von Literatur-, Geschichts- und Grundwissenschaft, um die kulturwissenschaftliche Öffnung der Heraldik zu befördern. Mithilfe eines kultursemiotisch-diskursanalytischen Ansatzes wird aus schriftlichen Zeugnissen ein elementarer kommunikativer Code der höfischen Kultur erschlossen und seine vielfältigen Formen der Inszenierung werden anhand exemplarischer Lektüren offengelegt.
Heraldische Zeichen sind heute zu Ornamenten unseres kulturellen Erbes erstarrt, dennoch lässt ihre Omnipräsenz erahnen, welche hohe symbolische und diskursive Macht einst von ihnen ausgegangen sein muss. In verschriftlichter Form fanden Wappen auch Eingang in die Literatur, ihr poetisches Potential ist aber bislang nur ansatzweise erforscht. In historisch-grundwissenschaftlicher Perspektive wurden heraldische Zeichen bis in die jüngere Zeit auf identifikatorische und repräsentative Funktionen reduziert, aus literaturwissenschaftlicher Sicht als Mikromotive und Textschmuck marginalisiert. Gegen beide Tendenzen zeigt die Studie grundlegend das ästhetische und narrative Bedeutungspotential des Heraldischen in der europäischen Literatur des Mittelalters (1170–1300) auf.
Die Studie fußt auf einem interdisziplinären Dialog von Literatur-, Geschichts- und Grundwissenschaft, um die kulturwissenschaftliche Öffnung der Heraldik zu befördern. Sie nimmt eine kulturanthropologische Perspektive auf einen elementaren kommunikativen Code ein und erörtert dessen Beitrag für die Konstitution der höfischen Gesellschaft und Literatur. Methodisch wird hierfür ein kultursemiotisch-diskursanalytischer Ansatz entwickelt, wonach Wappen ein Zeichensystem darstellen, das neben seinen Denotaten eine weitere Schicht an kultur- und epochenspezifischen Konnotationen aufweist; in diesem ‚heraldischen Code‘ manifestieren sich historische Wissensordnungen und Denkmuster insb. der ritterlich-höfischen Kultur, die im Rahmen von literarischen Texten simulativ erprobt und reflexiv ausgehandelt wurden.
Aufgebaut ist die Studie aus zwei großen Teilen: Im ersten Teil ‚Wappen erzählen‘ werden die Inszenierungsformen des heraldischen Codes systematisch aufgearbeitet und durch exemplarische Textanalysen vertieft. Dabei kommen deutsche, englische, französische und lateinische Quellen zu den Themen Poetologie, Identität, Symbolik, Intertextualität sowie zu den Diskursformationen des Heraldischen (Liebe, Religion, Politik) zur Sprache. Der zweite Teil ‚Wappen erlesen‘ widmet sich auf diachroner Ebene drei autor-, zeit- und textspezifischen heraldischen Poetiken, mit deren Hilfe sich die Grundzüge einer ‚heraldischen Literaturgeschichte‘ skizzieren lassen: Untersucht werden der mhd. Prosa-Lancelot samt altfrz. Vorlagen, das Turnier von Nantes Konrads von Würzburg im Kontext der altfrz. Turnierdichtungen und der am böhmischen Königshof entstandene Versroman Wilhalm von Wenden Ulrichs von Etzenbach.
https://www.germanistik.uni-wuerzburg.de/mediaevistik/team/hoder-manuel/
Manuel Hoder
seit 2023: Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für deutsche Philologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
03/2023: Promotion im Fach Germanistik (Prädikat: summa cum laude)
2021-2023: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Philologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
2016-2021: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Germanistik der Technischen Universität Braunschweig
2010-2016: Studium der Germanistk, Philosophie und Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main
Die „Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters“ (MTU) sind eine international hochrenommierte Reihe der germanistischen Mittelalterforschung. Sie stellt ausgewählte editorisch und methodisch-analytisch orientierte Arbeiten von Fachkollegen aus dem In- und Ausland für die wissenschaftliche Öffentlichkeit bereit. Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Reihe versteht sich als Forum für Publikationen zur Grundlagenforschung (Editionen, Untersuchungen zur Überlieferungs- und Textgeschichte, Standardrepertorien aus den Bereichen der material philology) wie auch für analytische Beiträge zur aktuellen Methodendiskussion anhand exemplarischer Untersuchungen.
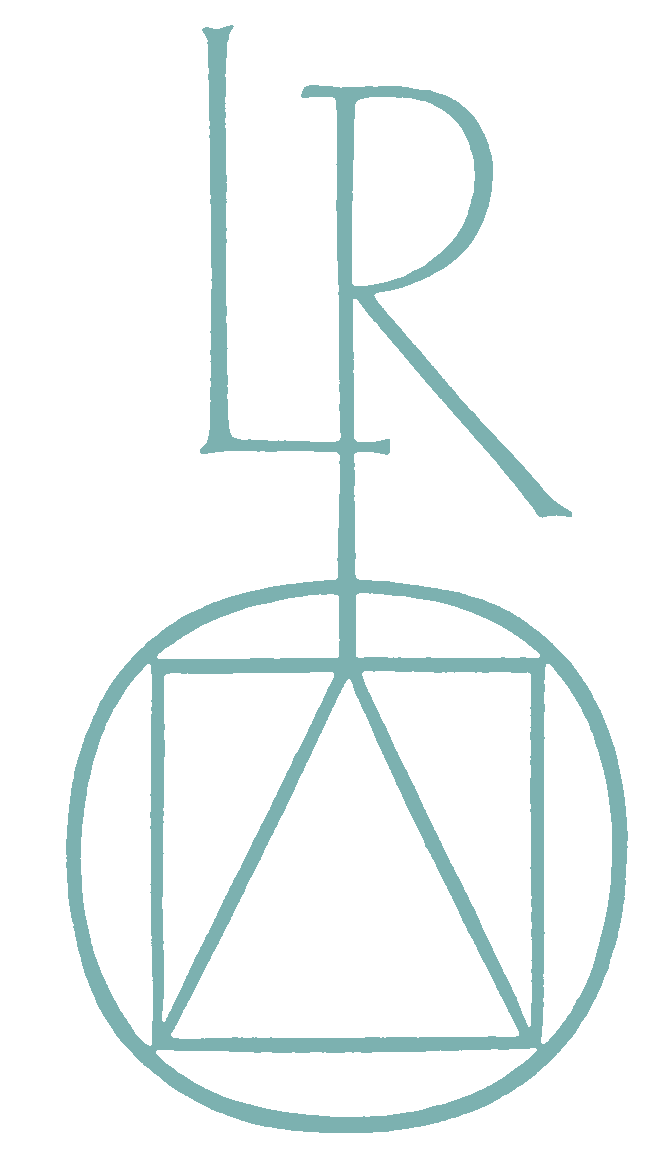

 Leseprobe
Leseprobe