Die Abschlusspublikation des SFB 1070 RessourcenKulturen bietet interdisziplinäre Einblicke in die Fragen, wie Ressourcen entstehen, wie Ressourcen genutzt werden, wie Ressourcen durch gesellschaftliche Prozesse beeinflusst werden und wie Ressourcen ihrerseits auf Gesellschaften rückwirken. Anhand konkreter Fallstudien aus räumlich und chronologisch verschiedenen Kontexten werden diese Dynamiken und Prozesse der Ressourcenwerdung und Ressourcennutzung exemplarisch und anwendungsorientiert diskutiert.
This book offers an in-depth exploration of the interplay between resources and societies, bridging insights from the humanities and natural sciences. Drawing on a robust theoretical framework, it extends the conventional understanding of resources to include their socio-cultural constructions across diverse temporal and spatial contexts. Through a series of compelling case studies ranging from prehistory to the present, the book explores material and immaterial resources, the infrastructures and networks in which they are embedded, and the complex dynamics of their use. It draws on the concepts of ResourceComplexes and ResourceAssemblages and provides innovative tools for analysing these interdependencies. By framing resources as cultural phenomena, this work unravels the multifaceted ways in which societies have been shaped by
and have reshaped their resource landscapes – culminating in the notion of ResourceCultures.
Martin Bartelheim, geb. 1964. Studium der Ur- und Frühgeschichte an der Freien Universität Berlin und der Karls-Universität Prag. Seit 2008 Professor für Jüngere Ur- und Frühgeschichte an der Eberhard Karls-Universität Tübingen. Forschungsschwerpunkte bilden die Bronze- und Eisenzeit in Mitteleuropa und im Mittelmeerraum, aktuell vor allem auf der Iberischen Halbinsel.
Roland Hardenberg (geb. 1967) forscht seit 1995 in Odisha, Indien. Seine ersten Forschungen befassten sich mit dem Gajapati-Königtum und der Erneuerung (nabakalebara) der Hauptgötter des Jagannatha Tempels in Puri, Odishas. Von 2001 bis 2003 führte er weitere Forschungen bei den Dongria Kond in den Niamgiri Bergen des Rayagada Distrikts von Odisha durch und befasste sich insbesondere mit den komplexen Heiratsritualen und den Büffelopfern für die Erdgöttin. Seit 2006 befasst sich Roland Hardenberg in der Forschung auch mit Zentralasien, insbesondere zur Bestattungskultur im Norden Kyrgyzstans. Von 2009 bis 2016 war Roland Hardenberg Direktor des Instituts für Ethnologie in Tübingen und trat 2016 die Nachfolge von Karl-Heinz Kohl als Professor für Sozial- und Kulturanthropologie der Goethe Universität Frankfurt sowie ab 2017 als Direktor des Frobenius-Instituts an. In den letzten Jahren hat sich Hardenberg vor allem im Kontext des Sonderforschungsbereiches 1070 mit religiösen Ressourcen in Süd- und Zentralasien befasst. Sei 2018 erforscht er außerdem zusammen mit Peter Berger und René Cappers von der Universität Groningen intensiv Getreide (Hirse und Reis) im Hochland von Odisha und ist Mitbegründer des Netzwerkes „Cereal Cultures“.
https://cerealcultures.com/Irmgard Männlein (*1970) studierte Klassische Philologie und Germanistik an der Universität Würzburg und in London (UCL). Sie wurde 2000 mit einer Arbeit über den Platoniker Longin in Würzburg promoviert (publ. München/Leipzig 2001). Nach ihrer Habilitation 2005 (Stimme, Schrift und Bild: Zum Verhältnis der Künste in der hellenistischen Dichtung, Heidelberg 2007), nahm sie einen Ruf auf den Lehrstuhl für Klassische Philologie/Gräzistik an die Universität Tübingen an. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf literarischen und philosophischen Aspekten bei Platon und im spätantiken Platonismus (v.a. Porphyrios), der antiken Religion sowie auf hellenistischer und spätantiker Poetik, Ekphrastik und Ästhetik.
Simone Riehl (*1966; Promotion an der Universität Tübingen, 1998) ist Wissenschaftlerin am Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment der Universität Tübingen, wo sie am Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie die Fächer Archäobotanik und Umweltarchäologie unterrichtet.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Archäologie des Nahen Ostens und die Paläoklimatologie, die sie an den Universitäten Basel, Tübingen, Sheffield und Madison-Wisconsin studierte. Riehl hat als Archäobotanikerin an mehreren archäologischen Ausgrabungen im Nahen Osten mitgearbeitet, darunter in der Türkei, Syrien, Libanon, Israel, Jordanien und Iran. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Entstehung und Entwicklung der Landwirtschaft sowie stabile Isotope in Pflanzenresten als paläoökologische Indikatoren.
Tobias Schade (geb. 1985) wurde an der Universität Kiel im Fach Ur- und Frühgeschichte promoviert. Seine Forschungsinteressen gelten unter anderem der Archäologie der Wikingerzeit sowie Fragen zu Authentizitätskonzepten und zur Geschichtskultur. Zurzeit ist er wissenschaftlicher Koordinator des SFB 1070 RessourcenKulturen an der Universität Tübingen.
Thomas Scholten (geb. 1960) ist Professor für Bodenkunde und Physische Geographie an der Eberhard Karls Universität Tübingen und Direktor des Geographischen Instituts. Seine Forschung widmet sich der Entwicklung und dem Schutz von Böden, dem Verständnis bodenerosionssteuernder und bodenökologischer Prozesse sowie der Entstehung und Veränderung von Landschaften. Im Laufe seiner akademischen Karriere hatte er Positionen an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, der Justus-Liebig-Universität Gießen sowie der Friedrich-Schiller -Universität Jena inne. Von 2012 bis 2015 war er Präsident der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft. Seit 2016 ist er Vollmitglied von Acatech, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften.
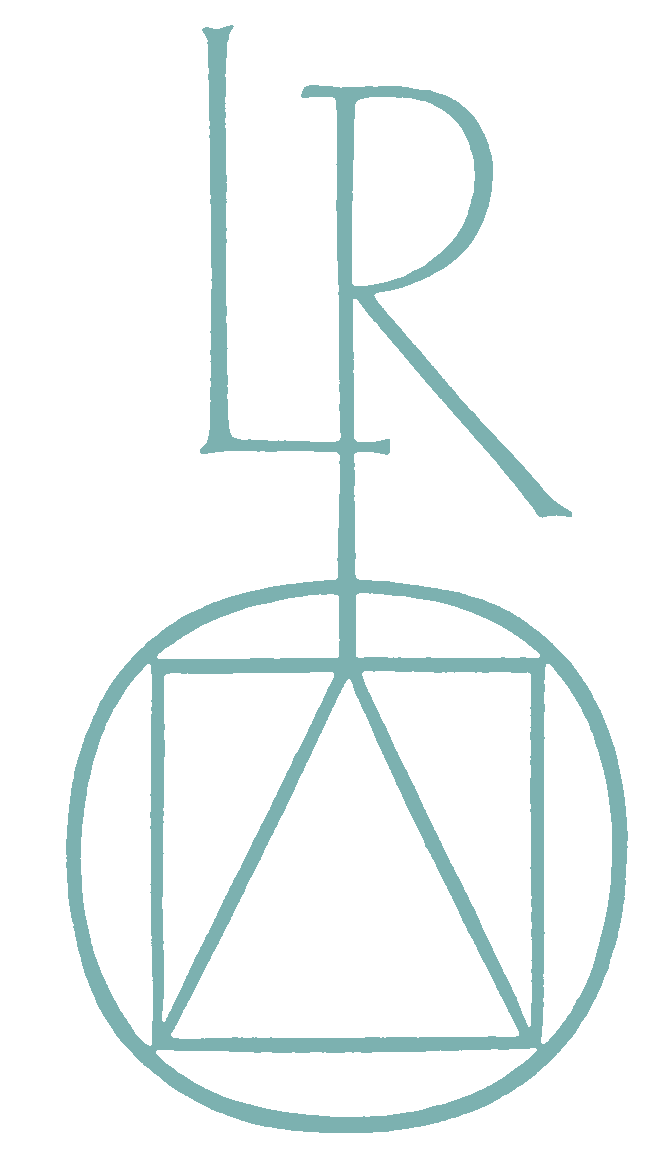

 Inhalt
Inhalt